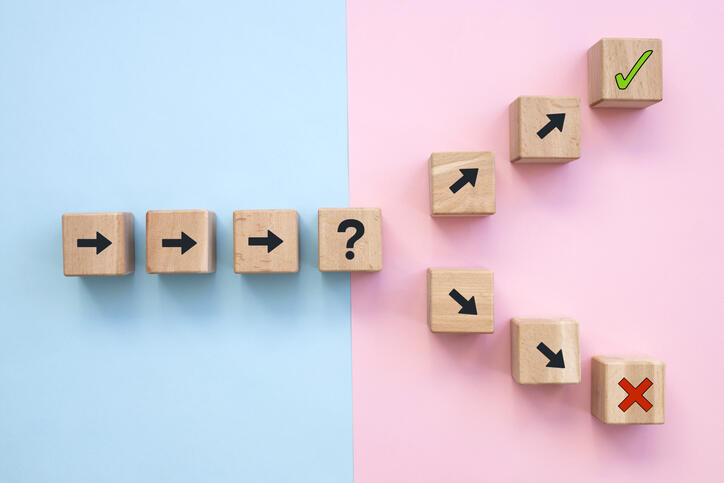Schwerpunkt: Flexible Wege ins Berufsleben: Verlängerte Lehre, Teilqualifikation und Anlehre
Berufliche Qualifizierung für Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf
Jeder Mensch bringt unterschiedliche Begabungen und Talente mit und verdient eine Chance, diese zu entfalten. Wenn eine reguläre Lehre nicht möglich ist, stehen andere Ausbildungswege offen: Bei der verlängerten Lehre erhalten Jugendliche mehr Zeit, um einen vollwertigen Lehrabschluss zu erlangen. Bei der Teilqualifikation werden nur bestimmte Teile eines Lehrberufs erlernt. In manchen Bundesländern gibt es zusätzlich die sogenannte Anlehre, die ebenfalls ausgewählte berufliche Qualifikationen vermittelt. Dieses Modell ist besonders geeignet für Jugendliche, für die eine Teilqualifizierung (noch) nicht in Frage kommt und die besondere Unterstützung brauchen.
Diese drei Ausbildungsmodelle bieten flexible und individuelle berufliche Chancen und Perspektiven – je nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Jugendlichen.
INFO: Die verlängerte Lehre und die Teilqualifikation werden in ganz Österreich angeboten. Die Anlehre wird in einzelnen Bundesländern unterschiedlich gestaltet und umgesetzt. Arbeitsmarktservice (AMS), Jugendcoaching und Berufsausbildungsassistenz finden gemeinsam mit den Jugendlichen und ihren Eltern die jeweils beste individuelle Lösung.
Voraussetzungen für die verlängerte Lehre und Teilqualifikation
Eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifikation kann von Jugendlichen absolviert werden, die vom Arbeitsmarktservice (AMS) nicht in ein Lehrverhältnis vermittelt werden konnten und entweder
- einen sonderpädagogischen Förderbedarf am Ende der Pflichtschule hatten und zumindest teilweise nach dem Sonderschullehrplan unterrichtet wurden,
- keinen bzw. einen negativen Abschluss der Mittelschule aufweisen,
- eine Behinderung laut Behindertengleichstellungsgesetz bzw. des jeweiligen Landesbehindertengesetzes aufweisen oder
- aus anderen persönlichen Gründen keine Lehrstelle finden können und dies bei einer vom Arbeitsmarktservice oder vom Sozialministeriumservice beauftragten fachlichen Beurteilung festgestellt wurde.
INFO: Die verlängerte Lehre und Teilqualifikation sind im Berufsausbildungsgesetz (BAG) für ganz Österreich einheitlich geregelt. Ein Wechsel zwischen beiden Ausbildungsformen ist unter bestimmten Voraussetzungen in beide Richtungen möglich.
Verlängerte Lehre – mehr Zeit für den Lehrabschluss
Die verlängerte Lehre dauert 1 bis maximal 2 Jahre länger als die normale Lehrzeit. Es werden alle Ausbildungsinhalte eines Lehrberufs erlernt – jedoch mit mehr Zeit und zusätzlicher Unterstützung während der Ausbildung. Der Lehrvertrag kann entweder gleich zu Beginn der Lehre oder im Laufe der Lehrzeit verlängert werden. Die Jugendlichen werden vor und während der gesamten Lehrzeit bis zur Lehrabschlussprüfung von der Berufsausbildungsassistenz betreut und begleitet, z.B. bei Problemen in der Berufsschule oder im Betrieb.
Die wichtigsten Fakten zur verlängerten Lehre:
- Alter: meist 15 bis 24/25 Jahre
- Dauer: Die Dauer richtet sich nach der regulären Lehrzeit im jeweiligen Beruf und kann um 1 bis maximal 2 Jahre verlängert werden.
- Vertrag: Im Lehrvertrag wird die Verlängerung der Lehrzeit festgehalten. Eine Verlängerung kann auch während der Lehrzeit vereinbart werden.
- Ort: Die Ausbildung findet in einem Betrieb oder einer in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung statt.
- Berufe: Eine verlängerte Lehre kann grundsätzlich in allen anerkannten Lehrberufen absolviert werden, muss jedoch individuell vereinbart werden.
- Berufsschule: Der Besuch der Berufsschule ist bei der verlängerten Lehre wie für alle Lehrlinge verpflichtend.
- Einkommen: Die Jugendlichen erhalten ein Lehrlingseinkommen. Wird die verlängerte Lehre überbetrieblich in einer Ausbildungseinrichtung absolviert, zahlt das AMS eine Ausbildungsbeihilfe.
- Abschluss: Am Ende der Ausbildung steht die reguläre Lehrabschlussprüfung
- Ziele nach dem Abschluss: Die verlängerte Lehre vermittelt einen vollwertigen Lehrabschluss, der einen direkten Einstieg als Fachkraft in einem Betrieb ermöglicht.
Teilqualifikation – Teile eines Lehrberufs erlernen
Die Teilqualifikation ist ein „maßgeschneiderter“ Ausbildungsweg, bei dem nur ausgewählte Teile eines oder auch mehrerer Lehrberufe erlernt werden. Abgestimmt auf die persönlichen Fähigkeiten wird in einem Ausbildungsvertrag genau festgehalten, welche Kenntnisse und Fertigkeiten eines Lehrberufs erlernt werden. Wie bei der verlängerten Lehre betreut die Berufsausbildungsassistenz die Jugendlichen während der gesamten Ausbildungszeit und begleitet sie auch beim Abschluss des Ausbildungsvertrags mit dem Lehrbetrieb. Am Ende der Ausbildung wird bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer eine Abschlussprüfung über die erlernten Inhalte abgelegt und ein Zeugnis über die erworbenen Teilqualifikationen ausgestellt.
Die wichtigsten Fakten zur Teilqualifikation:
- Alter: meist 15 bis 24/25 Jahre
- Dauer: Die Teilqualifikation dauert je nach Vereinbarung zwischen 1 und 3 Jahren.
- Vertrag: In einem offiziellen Ausbildungsvertrag werden die Teilinhalte eines Lehrberufs individuell vereinbart.
- Ort: Die Ausbildung findet in einem Betrieb oder in einer überbetrieblichen Ausbildungseinrichtung statt.
- Berufe: Eine Teilqualifikation ist in verschiedenen Lehrberufen möglich, z.B. aus den Bereichen Einzelhandel, Gartenbau, Grünraumpflege, Handwerk, Industrie oder Küche.
- Berufsschule: Der Besuch der Berufsschule ist mit einem individuell angepassten Lehrplan vorgesehen, aber nicht verpflichtend.
- Einkommen: Die Jugendlichen erhalten ein Lehrlingseinkommen. Wird die Teilqualifikation überbetrieblich in einer Ausbildungseinrichtung absolviert, zahlt das AMS eine Ausbildungsbeihilfe.
- Abschluss: Nach erfolgreicher Abschlussprüfung wird von der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer ein Abschlusszeugnis über die Teilqualifikationen ausgestellt.
- Ziele nach dem Abschluss: Möglich sind ein direkter Berufseinstieg als qualifizierte Hilfskraft in einem Betrieb oder weitere Ausbildungen, z.B. eine (verlängerte) Lehre. Wenn die Abschlussprüfung und das erste Berufsschuljahr in den berufsfachlichen Fächern positiv abgeschlossen wurden, kann mindestens ein Jahr auf die Lehre angerechnet werden.
INFO: Bei der Teilqualifikation werden jene Teile eines Lehrberufs, die erlernt werden, in der Regel individuell festgelegt. Ausnahme: In Oberösterreich gibt es vereinzelt auch das Modell einer standardisierten Teilqualifikation, bei der die Ausbildungsinhalte fix vorgegeben sind.
Die Anlehre – für Jugendliche mit höherem oder hohem Unterstützungsbedarf
Die Anlehre ist eine weitere Möglichkeit, sich berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten in einem Fachbereich oder Beruf zu anzueignen. Dieses Modell ist vor allem für Jugendliche gedacht, die besonders viel Unterstützung brauchen. Die Anlehre wird je nach Bundesland und Ausbildungseinrichtung in unterschiedlicher Form angeboten und kann besonders individuell gestaltet werden. Die Jugendlichen werden intensiv sozialpädagogisch betreut. Am Ende der Anlehre wird – je nach Ausbildungseinrichtung – ein Zeugnis, ein Zertifikat oder eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.
Die wichtigsten Fakten zur Anlehre:
- Alter: meist 15 bis 24/25 Jahre (vereinzelt auch älter)
- Dauer: Die Anlehre dauert je nach Vereinbarung zwischen 1 und 3 Jahren.
- Vertrag: In einem internen Anlehr- oder Ausbildungsvertrag zwischen Ausbildungseinrichtung und „Anlehrling“ werden Kenntnisse und Fertigkeiten festgehalten, die erlernt werden.
- Ort: Die Ausbildung findet in einer Ausbildungseinrichtung bzw. in Kooperation mit einem integrativen Betrieb statt.
- Berufe: Die Inhalte orientieren sich an Kenntnissen und Fertigkeiten aus verschiedenen Fachbereichen oder Lehrberufen, z.B. auch den Bereichen Einzelhandel, Gartenbau, Grünraumpflege, Handwerk, Industrie oder Küche.
- Berufsschule: Bei der Anlehre ist kein offizieller Berufsschulbesuch möglich.
- Einkommen: Je nach Förderung des Anlehreangebots wird z.B. ein Gehalt knapp über der Geringfügigkeitsgrenze oder eine Ausbildungsbeihilfe ausbezahlt.
- Abschluss: Die Jugendlichen erhalten ein Zeugnis, ein Zertifikat oder eine Teilnahmebestätigung. Eine Prüfung im eigentlichen Sinne gibt es meist nicht. Die Beurteilung erfolgt häufig durch Beobachtung.
- Ziele nach dem Abschluss: Möglich sind ein direkter Berufseinstieg als qualifizierte Hilfskraft in einem Betrieb oder weitere Ausbildungen, z.B. eine Teilqualifikation oder verlängerte Lehre. Achtung: Eine Anrechnung der Anlehre auf die Lehrzeit ist nicht möglich!
INFO: Die Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Anlehre können je nach Fördergeber und Projekt unterschiedlich sein. Meist ist ein Gutachten über den Grad der Beeinträchtigung erforderlich.
Welche Stellen sind zuständig?
- Arbeitsmarktservice (AMS): Ziel des AMS ist es, alle Jugendlichen in reguläre Lehrstellen zu vermitteln. Ist dies nicht möglich, wird in Abstimmung mit dem Jugendcoaching bzw. der Berufsausbildungsassistenz (siehe unten) versucht, ein geeignetes Qualifizierungsangebot zu finden. Bei anerkannten und geförderten Ausbildungen in überbetrieblichen Einrichtungen zahlt das AMS eine Ausbildungsbeihilfe zur Deckung des Lebensunterhalts (statt eines Lehrlingseinkommens). Bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen können auch Betriebe und Ausbildungseinrichtungen Förderungen vom AMS erhalten.
- Sozialministeriumservice: Als zentrale Stelle für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen fördert das Sozialministerium sowohl Projekte und Einrichtungen als auch unterstützungsberechtigte Personen – z.B. durch finanzielle Leistungen sowie begleitende Angebote zur beruflichen Integration (wie etwa Jugendcoaching und Berufsausbildungsassistenz).
- Jugendcoaching: Das kostenlose Angebot bietet Jugendlichen am Übergang zwischen Schule und Beruf Beratung und Unterstützung. Die Jugendcoaches finden gemeinsam mit den Jugendlichen heraus, welche Ausbildung oder Qualifizierung für sie am besten geeignet ist.
- Berufsausbildungsassistenz: Jugendliche, die eine Teilqualifikation oder verlängerte Lehre absolvieren, werden von Mitarbeitenden der Berufsausbildungsassistenz vor und während der gesamten Ausbildungszeit unterstützt, z.B. bei der Abwicklung des Lehr- oder Ausbildungsvertrags, bei Problemen im Betrieb oder durch Lernhilfe.
- Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammern: Die Lehrlingsstellen sind für die Eintragung von Lehr- und Ausbildungsverträgen sowie für Abschlussprüfungen (Teilqualifikation) und Lehrabschlussprüfungen (verlängerte Lehre) zuständig.
Einrichtungen und Ausbildungsanbieter
In ganz Österreich gibt es zahlreiche Einrichtungen, die Angebote und Projekte zur Qualifizierung von Menschen mit Unterstützungsbedarf durchführen, zum Beispiel:
- Burgenländisches Schulungszentrum (BUZ)
- ABC Service & Produktion Integrativer Betrieb GmbH (Kärnten)
- Jugend am Werk (Niederösterreich, auch österreichweit)
- Jugend am Werk/BBRZ (Oberösterreich)
- Rettet das Kind (Salzburg, auch österreichweit)
- Chance B (Steiermark)
- arbas (Tirol)
- Integratives Ausbildungszentrum Vorarlberg (IAZ)
- Wien Work
Tipps für Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben
- Glaub an dich! – Du hast viele tolle Fähigkeiten, die du während deiner Ausbildung neu entdecken und weiterentwickeln kannst.
- Setze dir erreichbare Ziele! – Schon kleine Schritte bringen dich voran.
- Hab keine Angst vor Fehlern! – Jeder Mensch macht mal etwas falsch, doch so lernen wir.
- Frag nach Hilfe! – Es ist vollkommen okay, um Unterstützung zu bitten, wenn du bei einer Aufgabe Schwierigkeiten hast.
- Freu dich über deine Erfolge! – Sei stolz, wenn dir etwas gut gelungen ist.
Teilqualifikation, verlängerte Lehre und Anlehre im Überblick
|
Verlängerte Lehre
|
Teilqualifikation
|
Anlehre
|
|
|
Alter*
|
15 bis 24/25 Jahre
|
15 bis 24/25 Jahre
|
15 bis 24/25 Jahre
|
|
Dauer
|
reguläre Lehrzeit plus 1 bis maximal 2 Jahre
|
1 bis 3 Jahre
|
1 bis 3 Jahre
|
|
Ort
|
normaler Betrieb, integrativer Betrieb oder Ausbildungseinrichtung
|
normaler Betrieb, integrativer Betrieb oder Ausbildungseinrichtung
|
Ausbildungseinrichtung bzw. integrativer Betrieb
|
|
Inhalte
|
Ausbildungsinhalte der
regulären Lehre
|
bestimmte Teile
eines Lehrberufs
|
bestimmte Teile eines Fachbereichs oder Lehrberufs (auch sehr einfache Tätigkeiten)
|
|
Begleitung
|
Berufsausbildungsassistenz
|
Berufsausbildungsassistenz
|
sozialpädagogische Betreuung durch die Ausbildungseinrichtung
|
|
Einkommen
|
Lehrlingseinkommen bei Ausbildung im Betrieb oder Ausbildungsbeihilfe bei überbetrieblicher Ausbildung
|
Lehrlingseinkommen bei Ausbildung im Betrieb oder Ausbildungsbeihilfe bei überbetrieblicher Ausbildung
|
kein Lehrlingseinkommen; je nach Angebot bzw. Fördermodell, z.B. Ausbildungsbeihilfe oder Gehalt knapp über der Geringfügigkeitsgrenze
|
|
Berufsschule
|
verpflichtend
|
vorgesehen, aber nicht verpflichtend
|
kein offizieller Berufsschulbesuch möglich
|
|
Prüfung
|
Lehrabschlussprüfung bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer
|
offizielle Abschlussprüfung bei der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer
|
keine offizielle Abschlussprüfung
|
|
Abschluss
|
vollwertiges Lehrabschlussprüfungszeugnis
|
Abschlusszeugnis über die erlernten Teilqualifikationen
|
Abschlusszeugnis, Zertifikat oder Teilnahmebestätigung
|
|
Ziel
|
Berufseinstieg als gelernte Fachkraft im jeweiligen Lehrberuf
|
Berufseinstieg als qualifizierte Hilfskraft in einem Betrieb oder weitere Ausbildung (z.B. Lehre)
|
Berufseinstieg als qualifizierte Hilfskraft in einem Betrieb oder weitere Ausbildung (z.B. Teilqualifizierung, verlängerte Lehre)
|
*Die genauen Altersgrenzen können sich je nach Ausbildungsangebot unterscheiden.